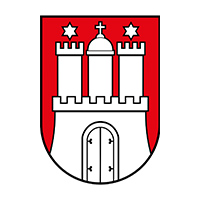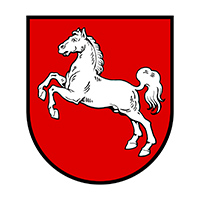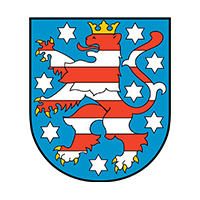Das „Hamburger Modell“ und die Vergnügungssteuer
(Dr. Andreas Bartosch) Am 20. Juni 2024 hat die Europäische Kommission am Ende des sog. förmlichen Prüfverfahrens gemäß Artikel 108 Absatz 2 AEUV einen Negativbeschluss angenommen, in dem sie die Steuerregelungen in den 16 deutschen Landesspielbankgesetzen betreffend die besondere Besteuerung von Spielbankunternehmen für beihilferechtswidrig erachtete und die Rückforderung der Letzteren gewährten Steuervorteile anordnete. In den…